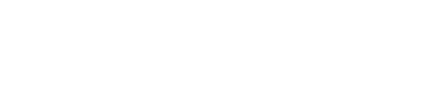Angebot Logopädischer Dienst
Eltern oder Lehrpersonen können sich bei uns melden, wenn sie Fragen zur Sprache ihres Kindes oder Schülerin haben.
- Sie sind verunsichert, weil Ihr dreijähriges Kind nicht oder nur sehr wenig spricht
- Sie bemerken, dass Ihr Kind für Aussenstehende schwer verständlich ist, weil es Laute nicht richtig bildet und Sätze verdreht
- sie sind beunruhigt, weil Ihr Kind nicht fliessend spricht und häufig an Satzanfängen und Wörtern hängen bleibt.
- Sie fragen sich, warum ihr Kind immer eine heisere Stimme hat, auch wenn es nicht erkältet ist.
- Sie haben Fragen, weil Ihr Schulkind Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens hat.
Logopädinnen können bei diesen Fragen unterstützen und beraten. Wir bieten falls notwendig eine umfassende Abklärung, Beratung oder Therapie an. Wir sind Fachpersonen in folgenden Bereichen:
Störungen des Sprechens und der Sprache
- Artikulationsstörungen
- Ausbleiben oder Verzögerung der Sprachentwicklung
- Sprachverständnisstörung
- eingeschränkter Wortschatz
- Wortfindungsstörungen
- Dysgrammatismus
- Wahrnehmungsstörungen
Störungen beim Schriftspracherwerb oder der mathematischen Sprache
- Dysorthografie
- Dyslexie
- Rechenstörungen in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache
Weitere Störungen der Sprache, des Redeflusses und der Stimme
- An-/Dysarthrie
- A-/Dysphasie
- Stottern
- Poltern